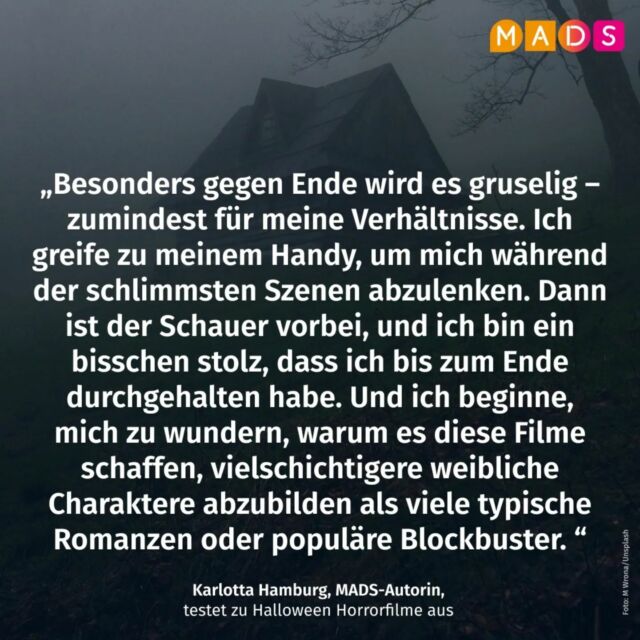Wolken im Kopf: Marie (23) erzählt, wie sich ihre Depressionen anfühlen

Seit sie ein junges Mädchen ist, leidet Studentin Marie an Depressionen. MADS erzählt sie, wie psychische Erkrankungen das Leben verändern können.
Wenn Marie sich mit ihren Freunden verabredet, erscheint sie auch. Das war aber nicht immer so. Bis vor einem Jahr sagte sie geplante Verabredungen immer wieder kurzfristig ab. Der Grund: Die Studentin leidet an Depressionen. „Mir hat einfach die Kraft gefehlt, meine Wohnung zu verlassen“, sagt sie. Heute ist die 23-Jährige nicht mehr in Therapie und nimmt auch keine Medikamente mehr. Sie sagt, sie hat gelernt, ihren Alltag zu bewältigen.
„An manchen Punkten meines Lebens habe ich nicht daran geglaubt, dass ich es schaffe.“
Marie (23), Studentin
„Ich hatte immer das Gefühl, ich ertrinke“, beschreibt Marie, die eigentlich anders heißt, ihre Depressionen. „Es fühlt sich an, als umgebe mich eine schwarze Wolke.“ Es sei, als würde sich ihr Brustkorb zusammenziehen. Dann werde sie ängstlich und schließlich traurig. „Ich fühle mich in meinen depressiveren Phasen – auch heute noch – betäubt.“ Marie könne dann ihre Umwelt nicht mehr so wahrnehmen wie normalerweise. „Bei Treffen mit Freunden habe ich versucht zu lachen und das Verhalten der anderen widerzuspiegeln“, sagt die Studentin. „Ich habe versucht, mich so zu verhalten, wie es meiner Meinung nach von mir erwartet wurde.“

Symbolbild: Priscilla Du Preez
Mit elf Jahren hat Marie selbst erste Anzeichen ihrer Depression wahrgenommen. „Die konnte ich damals aber noch gut überspielen“, sagt sie. Sechs Jahre später – mit 17 – haben die heute 23-Jährige dann dauerhafte Kopfschmerzen geplagt. Nach einer intensiven Krankenhaustour durch diverse medizinische Abteilungen, konnten die Ärzte körperliche Beschwerden als Ursache für die anhaltenden Kopfschmerzen der jungen Frau ausschließen. „Es mussten also psychosomatische Kopfschmerzen sein“, sagt Marie. Die dafür verantwortlichen Ursachen mussten therapeutisch behandelt werden.
Von der Therapie bei einer Kinder- und Jugendtherapeutin war die damals 17-Jährige jedoch wenig überzeugt: „Ich hatte keine Lust auf die Therapie“. Sie habe sich gegenüber ihrer Therapeutin auch nur schwer ausdrücken können. „’Ich fühle mich nicht so gut’ hieß damals, dass ich den halben Tag geheult habe“.
Welcher Auslöser letztlich für Maries Depressionen sorgte, weiß Marie bis heute nicht genau. In der Therapie hat sie versucht, das herauszufinden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit habe im Kleinkindalter von null bis drei Jahren ein traumatisches Ereignis in ihrem Leben stattgefunden. „Der Druck in der Schule war dann der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat“, erklärt Marie. Deshalb habe sie damals ihr Abitur dann auch nicht gemacht. Mittlerweile hat die 23-Jährige aber ein Fachabitur in der Tasche und befindet sich in der Abschlussphase ihres Studiums.
Über Wochen nicht geredet
„Ich habe immer gemerkt, dass ich nicht so viel Kraft habe wie andere Jugendliche“, erzählt die Studentin. Damals wollte sie nicht darüber nachdenken, warum sie ist, wie sie ist. Sie nahm es einfach hin und hatte deswegen nie selbst das Bedürfnis, sich Hilfe zu suchen. Erst die andauernden psychosomatischen Kopfschmerzen haben Marie die Grenzen ihres Körpers aufgezeigt.

Die erste Diagnose der Therapeutin lautete: Depressionen. Das sei ein großer Schock für die damals 17-Jährige gewesen. „Gleichzeitig war da aber eine ganz kleine und leise Stimme, die gesagt hat: ‚Damit kann ich mich jetzt identifizieren und ich weiß, was los ist‘“, sagt Marie. „Als ich 18 war, wurde es so schlimm, dass ich nicht mehr zur Schule gegangen bin“, erzählt sie und berichtet von ihrem Zusammenbruch nach der Diagnose. „Ich habe nichts mehr gegessen und über Wochen nicht geredet“. Daraufhin habe sich ihre Mutter um einen Platz in stationärer Behandlung gekümmert, den sie dann auch schnell bekam.
Marie ist nicht alleine
„Als ich in die psychosomatische Klinik kam, habe ich gemerkt, dass ich nicht alleine bin, dass es auch andere gibt mit den gleichen Schwierigkeiten“, erinnert sich Marie an ihre Ankunft auf der Station für junge Erwachsene. „Ich habe mich endlich verstanden gefühlt.“ Zusätzlich zu ihren Depressionen wurde während ihres Klinikaufenthalts eine posttraumatische Belastungsstörung – also eine psychische spätere Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder schweres Trauma diagnostiziert. In der stationären Behandlung hat Marie gelernt, mit ihrer Diagnose umzugehen – und mithilfe eines Stundenplans wieder einen Alltag und eine Routine für sich zu schaffen. Ein halbes Jahr verbrachte Marie in der Klinik. Nach ihrer Entlassung zog sie für zwei Jahre in eine betreute Wohngemeinschaft für psychisch erkrankte Jugendliche. Die Einrichtung wurde ihr damals über das Jugendamt vermittelt.
Auch wenn sie heute offen über ihre Diagnose sprechen kann: Anfangs schämte Marie sich für ihre Depressionen – sie fühlte sich schuldig. Immer wieder machte sie sich Vorwürfe, nicht genug dafür getan zu haben, um keine Depressionen zu bekommen. „Ich habe mir gedacht: ‚Ich bin nicht normal, mit mir stimmt was nicht, ich muss mich dafür schämen‘“, sagt die Studentin. In den vergangenen Jahren habe sie sich aber mehr und mehr gegenüber anderen öffnen können und redet mittlerweile mit Freunden offen über ihre Erkrankung. Das hat die 23-Jährige viel Kraft gekostet. „An manchen Punkten meines Lebens habe ich nicht daran geglaubt, dass ich es schaffe“, sagt Marie.
Mehr Aufklärung
Marie redet auch über ihre Depressionen, um zu sensibilisieren. Die 23-Jährige wünscht von der Gesellschaft nämlich mehr Aufklärung über psychische Erkrankungen und einen vorsichtigeren Umgang mit den Diagnosen. „Die Diagnose ist ein Stempel“, sagt sie. „Und sobald sie gestellt wird, beeinflusst sie das Leben der Person – ob sie stimmt oder nicht.“ Während ihres Freiwilligen Sozialen Jahres, das die junge Frau gemacht hat, habe sie sich oft stigmatisiert gefühlt. „Es hat mich total wütend gemacht, dass man mir dort weder Verantwortung übergeben hat, noch Vertrauen mir gegenüber hatte“, sagt Marie. Nur weil sie Depressionen hat, hieße das nicht, sie könne ihrer Arbeit nicht professionell nachgehen. „Mehr Aufklärung sollte nicht dazu führen, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen nur mit Samthandschuhen angefasst werden“, meint sie.
Von Lucas Kreß
Wer hat Anspruch auf eine Psychotherapie?

Laut dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband) hat in Deutschland jeder, der von einer psychischen Erkrankung betroffen ist, einen Anspruch auf eine psychotherapeutische Behandlung. Dabei sei die Voraussetzung für eine psychotherapeutische Behandlung ein Erstgespräch mit einem Psychotherapeuten.
An den Terminservicestellen der kassenärztlichen Vereinigungen werde Betroffenen innerhalb von vier Wochen – nach Kontaktaufnahme – ein Termin für eine Sprechstunde mit einem Psychotherapeuten oder eine psychotherapeutische Akutbehandlung vermittelt.
Wer übernimmt die Kosten einer Psychotherapie? Verfügt der Psychotherapeut über eine Kassenzulassung, übernehmen alle gesetzlichen Krankenversicherungen die Kosten für die Therapie vollständig. Denn die Psychotherapie zähle zur Regelversorgung.
Du brauchst Hilfe?
Bei der Telefonseelsorge hören dir ausgebildete Seelsorger zu, können dir helfende Adressen nennen und sich um deine Probleme kümmern. Anonym kannst du sie telefonisch, per Chat oder Email erreichen.
Unter der Telefonnummer 0800 / 111 0 111 oder 0800 / 111 0 222 und
per Mail und Chat unter online.telefonseelsorge.de bekommst du Hilfe.
Von Lucas Kreß