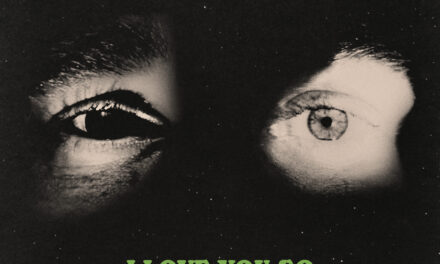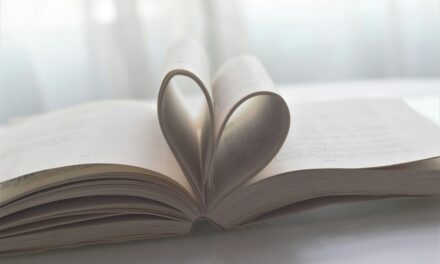Warum bekommt man einen Kater?

Picheln, saufen, einen zur Brust nehmen, zischen, auslitern, bechern, vollnebeln oder wegbeamen – fürs Trinken von Alkohol gibt es viele Bezeichnungen. Gar nicht verschieden ist die Wirkung des Fusels. „Wenn der Alkohol die Nervenzellen im Gehirn erreicht, wird Dopamin, im Volksmund Glückshormon genannt, ausgeschüttet“, erklärt Ronny Helfensteller, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Chemie der Universität Rostock.
Das Hormon sorgt für gute Laune, gesteigerte Kommunikationsfähigkeit und enthemmende Impulse. Wer über eine „gesunde“ Dosis geht, bekommt es dann auch noch mit Schwindel, Störungen im Seefeld, Übelkeit und einem Kater am kommenden Tag zu tun. Denn die Droge muss durch die Leber erst einmal abgebaut werden: ein biochemisch komplexer Vorgang. Aus Ethanol wird mit Hilfe von Enzymen Azetaldehyd (schön giftig!), daraus Essigsäure, daraus CO2 und Wasser.
Azetaldehyd sorgt für Katerstimmung
Warum heißt es eigentlich „Kater“?
Das Wort „Kater“ als Bezeichnung für Unwohlsein und Kraftlosigkeit nach übermäßigem Alkoholgenuss stammt aus dem 19. Jahrhundert. Studenten leiteten das Wort scherzhaft aus Katarrh ab, obwohl der Kater nicht mit einer Entzündung von Schleimhäuten zu tun hat. Der „Katzenjammer“, zu Goethes Zeiten sagte man Kotzen-Jammer, startet im Schnitt sechs bis acht Stunden nach dem Genuss von zu viel Alkohol. Der Kater ist die Folge einer Alkoholvergiftung und kann bis zu drei Tage andauern.
Von Klaus Amberger