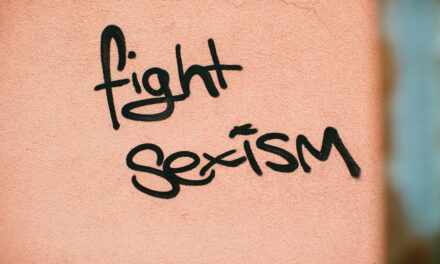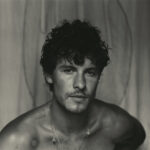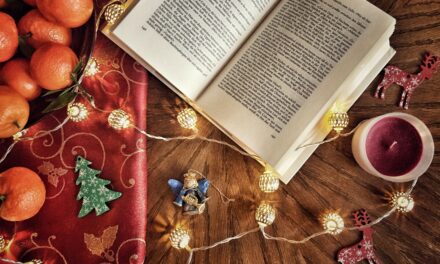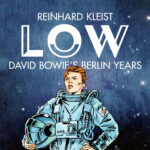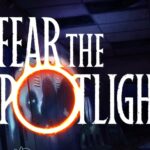Der Roman „James“: „Huckleberry Finn“ aus der Perspektive eines Sklaven

Neuerzählungen sind ein aktueller Trend, sowohl Bücher als auch Filme werden aus anderen Perspektiven wiedergegeben. Jetzt hat Percival Everett den US-amerikanischen Klassiker „Huckleberry Finn“ neuerzählt – aus Perspektive des Schwarzen Sklaven James.
In „Huckleberry Finn“ von Mark Twain geht es um das Abenteuer zweier weißer Jungen, Huck und Finn, die mit einem Floß über den Mississippi in den Südstaaten fahren. Nun wird der Klassiker aus dem 19. Jahrhundert von Percival Everett neu erzählt – aus der Perspektive des Sklaven James.
James und die dummen Weißen
Die Geschichte wird aus James Perspektive in der Ich-Form erzählt: Direkt zu Beginn werden dabei rassistische Klischees entlarvt. Als unfreier Sklave bringt James zu Beginn Schwarzen Kindern bei, ordentlich „schwarz“ zu sprechen. Sie sollen absichtlich dumm klingen, damit die eigentlich dummen Weißen sie für angemessen dümmlich halten. „Sei klug und stell dich vor den Weißen dumm.“ Dies ist das Motto, das die Schwarzen Kinder verinnerlichen sollen. Denn ein dummer Sklave kriegt weniger Ärger als einer, der Widerworte leistet.
Doch als James erfährt, dass er verkauft und von seiner Frau und seinem Kind getrennt werden soll, begehrt er auf und flüchtet. Als „Entlaufener“ ist er nun vogelfrei. Bald stößt Huck zu ihm, der vor seinem gewalttätigen Vater geflohen ist, und sein Zimmer, um eine Verfolgung zu vermeiden, mit angeblichem Blut beschmiert hat. Nun kann James erst recht nicht zurück, da die Weißen im Ort denken, dass er den Jungen ermordet hat. Also paddeln sie zusammen über den Mississippi.
Percival Everett entlarvt Klischees
Unterwegs begegnen sie allen möglichen Gestalten, die sämtliche rassistische Stereotype entlarven. Die beiden weißen Gauner, die sich als angeblich verarmte Adlige ausgeben und James und Huck schamlos erpressen, ähneln zum Beispiel jenen Vorstellungen, die Weiße zu der Zeit von kriminellen Schwarzen hatten. Auch die weißen Sänger, die ihre Gesichter schwarz anmalen, um als „Blackfaces“ auf ländlichen Bühnen dem weißen Publikum eine rassistische Darbietung zu geben, nutzen das „Schwarz-Sein“, wie Weiße es wahrnehmen, für ihre diskriminierende Performance. Gekonnt zieht Everett jene falsche weiße Vorstellung des „Schwarz-Seins“ ins Lächerliche. Denn James tritt mit den Sängern auf, ein Schwarzer, schwarz angemalt, um als Weißer zu gelten, der sich schwarz angemalt hat.
Eine wichtige Perspektive
„James“ gibt einer Schwarzen Perspektive Raum, die in den USA immer noch zu kurz kommt. Lediglich das zu abrupte Ende des Romans wird James Stimme nicht ganz gerecht. Der Roman zeigt, wie tief der Rassismus als Machtinstrument und gesellschaftliche, gewalttätige Ordnung die Charaktere beherrscht und regt zum Nachdenken an, von welchen rassistischen Vorurteilen Menschen heute noch immer geprägt sind.
Von Lisa Neumann
Lies auch: