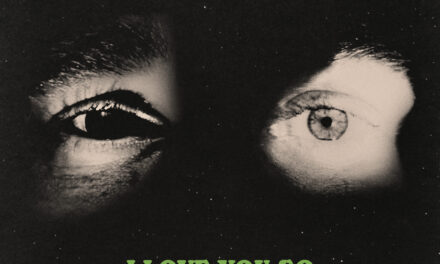„Deadpool 2″ und mehr DVD-Tipps

Ein ungewöhnlicher Western, der den Mythos von den harten Jungs im Sattel relativiert, ein Super-Antiheld, der Gruppendynamik und Verantwortungsgefühl lernen soll, eine prachtvolle Serienzeitreise in das Berlin der 20er Jahre, Denzel Washington als einsamer Anwalt mit altmodischem Ehrenkodex, und die erschütternde Dokumentation der Geschichte eines Folteropfers: dies und mehr in den DVD-Tipps von MADS.
The Rider. Wir sind in der Welt, in der Mann sein Pferd „Partner“ nennt. Eine Stute hat Brady Blackburn (Brady Jandreau) beim Rodeo schwer am Kopf verletzt. Er hat sich zu früh aus dem Krankenhaus entlassen. Auf eigene Faust. Jeder weitere Ritt in der Arena kann seinen Tod bedeuten. Aber Reiten ist Bradys Leben. Was wird er tun? Alles riskieren oder sein Leben in traurigen Jobs grau werden lassen?
Jandreau ist großartig im Zwiespalt, ein Gesicht, auf dem sich nichts und alles zugleich abspielt. Regisseurin Chloé Zhao, gebürtige Chinesin, präsentiert uns einen stoischen Cowboy als Helden eines Films, der zum einen authentisch wie eine Dokumentation wirkt. Wenn Brady dann aber an dem schlichten Holzkreuz seiner Mutter „Ich war stark, Mom“ flüstert, oder Kameramann Gokhan Tiryaki den Himmel über den Badlands leuchten lässt, bekommt man aber auch ein Westerngefühl.
„Man reitet durch den Schmerz“, sagt einer von Bradys Kollegen pathetisch am Lagerfeuer. Deprimierend ist Bradys Besuch bei dem schwer verunglückten Star-Bullenreiter Lane im Reha-Center, für dessen Genesung die Cowboys beten, dessen Ritt durch den Schmerz aber sicher nie wieder auf einem Pferd stattfinden wird. Alle Laienschauspieler hier zeigen Alternativversionen ihres Lebens, Bradys behinderte Schwester Lilly wird von Jandreaus wirklicher Schwester gespielt, auch ist der Vater im Film Bradys echter Vater.
Lane ist auch im wirklichen Leben nach einem Rodeounfall schwer behindert. Das Drama eines entbehrungsreichen Trailerlebens, das Zhao hier entfaltet, relativiert den Mythos von den harten Jungs im Sattel. Die Cowboys sind besorgt, zärtlich, sie sagen sogar Sachen wie „Ich liebe dich“. Wenn das John Wayne wüsste!
Deadpool 2. „Deadpool 2“ ist der Film, der dem rotschwarz gewandeten Einzelkämpfer mit den Samuraischwertern Gruppendynamik und Verantwortungsgefühl beibringen soll, ein Familienfilm aus Marvels seit je recht familiärem X-Men-Universum. Der Held trifft auf den zornigen jugendlichen Mutanten Russell (Julian Dennison), der Feuerfäuste schleudern kann, im Begriff scheint, Amok laufen zu wollen, und akut eine vertrauenswürdige Vaterfigur braucht.
Der depressive Einzelgänger Deadpool ist da nach dem Tod seiner Freundin Vanessa zunächst ein empathischer Totalausfall. Freilich bekommt er eine zweite Chance: Denn aus der trüben Zukunft reist ein Cyborg namens Cable (Josh Brolin) an, der den Jungen Russell töten will, um zu verhindern, dass dieser eines Tages seine Frau und Tochter zu Asche verbrennt. Vanessas Geist redet Deady ins Gewissen, er gründet die X-Force, um Russell alias Firefist zu retten. Und Action!
Was bei „Deadpool“ nicht nur heißt, dass während der üblichen Superheldenfilmefights infrastrukturelle Superschäden angerichtet sondern dass auch supermakabre Todesarten vor Augen geführt werden. Wie im ersten Film wendet sich der Antiheld dabei immer wieder mal direkt an den Zuschauer. Der Terminator lässt grüßen, und die Buddy-Filme der Achtzigerjahre mit ihren Coole-Sprüche-Gefechten grüßen mit. Und insgesamt hat man schon den Eindruck: Lustig.
Aber nicht so lustig wie der erste Film. Was vielleicht nicht einmal so sehr daran liegt, dass Regisseur Tim Miller wegen kreativer Differenzen mit Ryan Reynolds (Schauspieler mit Mitspracherecht!) ausschied, und David Leitch mittendrin für ihn einspringen musste. Sondern dass das Überraschungsmoment einfach weg ist, und viel vom Besten hier nicht besser sondern nur Mehr vom Selben ist. Ein wenig stört auch die Story. Daddy Deadpool? Schmalz und Tränen? Ja, sind wir hier denn in „Bambi“?
Jean Améry – Die Tortur. Das Arsenal verworrener Misideen des Nationalsozialismus beschwört der österreichische Schriftsteller Jean Améry (1912 – 1978) in diesen alten Lesungen herauf. Und das Wesen der Täter: „Sie folterten deshalb, weil sie Folterknechte waren“. Ein Gemarterter erinnert sich an sein Leiden in der belgischen Festung Derloven, findet in seinem sanften, freundlichen Tonfall Worte, die seine zwei Jahre in der NS-Gefangenschaft zu illustrieren vermögen.
Durch rötlich dünn erleuchtete Korridore wird er in den Bunker der Feste gezerrt, wo er erleidet, was ein nicht wieder gut zu machender Einschnitt in jedes Menschenleben ist. Aufgehängt an einer Eisenkette einen Meter über den Boden, soll er unter Schmerzen die Namen und Verstecke anderer Widerständler preisgeben. Krachen und Splittern in den Schultergelenken, ausgerenkte Arme –Tortur, so erklärt Améry, kommt vom lateinischen Wort für „verrenken“. Für detaillierte Beschreibungen fehlen ihm zwar nicht die Worte, wohl aber die Bereitschaft: „Der Schmerz war, wie er war.“
Regisseur Dieter Reifarth bebildert Amérys erschütterndes Analysieren und Begreifen, indem er die Kamera an den Mauern entlangfahren lässt. Die Bilder zeigen schwarzgrauen, narbigen Stein, dunkle Korridore, in den Stein geritzte Botschaften: „Courage“ und „Victoire!“. Dazu kommen Nachstellungen von Foltermassnahmen, die die unbegrenzte Fantasie menschlicher Quälfreude ahnen lassen.
Ein Plädoyer für die Menschlichkeit in Zeiten, in denen verbogene Geister die zwölf mörderischen Jahre des Dritten Reichs, die Diktatur der Diktaturen, als „Vogelschiss in der deutschen Geschichte“ abtun, und in denen sich bei nicht wenigen der Verdacht einschleicht, diese weltblinden Romantiker des Unheils würden liebend gern einen zweiten „Vogelschiss“ setzen.
The Walking Dead – Staffel 8. Die „New York Times“ schrieb im Vorjahr, die „Walking Dead“ begännen sich mit der achten Staffel im Kreis zu drehen. Und obwohl es immer noch einigermaßen spannend ist, was der Überlebendentruppe um Rick Grimes (Andrew Lincoln) widerfährt, leidet die Serie nach den Comics von Robert Kirkman doch zu sehr am déjà vu.
Die in der ersten Staffel im intelligent scheinenden Blick eines jungen „Beißers“ angedeutete Möglichkeit, die Zombies könnten sich zu einer Art Gegenspezies „entwickeln“ (wie in den Verfilmungen von Richard Mathesons Roman „Ich bin Legende“) wurde verworfen. Die Zombies wandelten sich im Laufe der Staffeln von einer gewaltigen Bedrohung zum Endzeit-Kolorit, zu einer beiläufig zu erledigenden Nebensache.
Der Mensch wurde dem Menschen in dieser Serie stattdessen zunehmend zum Wolf, die Wölfe immer schlimmer. Vom Redneck Merle über den durchgeknallten Governor bis hin zum noch zehnmal durchgeknallteren Negan (Jeffrey Dean Morgan), den es nun in der achten Staffel zu bekämpfen gilt. Getrieben von der Suche nach einer wahrhaft demokratischen Zelle, einer sicheren Heimat, einem Neubeginn, muss zunächst der rechte Populist und Diktator beseitigt werden.
Das geschieht auf eine relativ enttäuschende Art, die völlig unglaubwürdige Konsequenzen nach sich zieht. Während man für die soeben auf DVD erschienene achte Staffel also eine eher negative Bilanz ziehen muss, wird ihre Sichtung dennoch empfohlen. Deutet sich doch eine Art „Bürgerkrieg“ unter Ricks Leuten an, und nähert sich mit den „Whisperers“ die bei weitem größte und gefährlichste Zombieherde. Staffel 9 dürfte über die Zukunft dieser Serie entscheiden.
American Horror Story 7 – Cult. Eigentlich glaube er nicht an den Teufel, aber Donald Trump bringe ihn da schon ins Zweifeln, singt Will Hoge in „My American Dream“ – einer brandneuen Platte voller Rock’n’Roll und einer Sauwut auf die amerikanische „Situation“. Die Welt fühlt sich erstmals an, als stünde sie wirklich auf der Kippe, seit der Mann, der nicht mal in der Lage ist, die US-Flagge korrekt zu skizzieren, US-Präsident und damit mächtigster Mann der Welt ist.
Und so ist die gruseligste Szene in „Cult“, der siebten Staffel von „American Horror Story“, die, in der der Noch-Nicht-Potus im Wahlkampf sagt: „Ich könnte jemanden erschießen und würde nicht eine Stimme verlieren.“ In der Folge versucht „AHS“ diese Präsidentschaft als den Beginn eines neuen, finsteren Zeitalters zu sehen. Politische Satire trifft auf die Twilight Zone.
Die Clinton-Unterstützerin und Lesbierin Ally Mayfair-Richards (Sarah Paulsen) vergießt Tränen, als klar wird, wer der 45. Präsident wird, ein durchgeknallter Alt-Right-Freak (Evan Peters) freut sich („Die Revolution hat begonnen“) und der Verkäufer im menschenleeren Supermarkt hat ein gruselig leeres Grinsen drauf, wenn er sagt: „Endlich haben wir mal einen richtigen ,Führer‘ in Washington.“
Zwar wird „AHS“ nach diesem Auftakt eine weitere amerikanische Horrorstory mit Horrorclowns und Co., immer mit dem alten Problem befrachtet, dass krass übertourender Schrecken massiv an Bedrohlichkeit einbüßt, die Vorstellungskraft seines Betrachters schwächt. Aber das allerorten herrschende Grundgefühl, dass ein neuer böser Ton sich in der ganzen Welt eingerichtet hat und nicht verklingen will, ein Ton der Brutalität, Intoleranz, offenen Gemeinheit, bildet den verstörenden Humus, auf dem diese Geschichte gedeiht.
Rationale Zuschauer erleben passable Unterhaltung und wissen, dass die Demokratie nicht so schnell aus der Welt gefegt werden kann. Paranoiker indes nicken am Ende der elf Episoden wissend: Eine Machtergreifung des Bösen, eine Herrschaft des Unappetitlichen, eine Politik der Entzweiung und des Krieges hat begonnen, wurde von langer Hand vorbereitet. Trump und die überall sprießenden rechten Populisten sind der neue Versuch dessen, was der Teufel, dessen Existenz auch der Sänger Will Hoge wieder in Betracht zieht, zuvor nicht geschafft hat.
Babylon Berlin – Staffeln 1 und 2. Unsere Welt, wie sie vor uns war. 90 Jahre gehen die Regisseure Tom Tykwer, Hendrik Handloetgen und Achim von Borries in die deutsche Vergangenheit. Es ist die Zeit, in der sich die politische Extreme formiert, in der Demonstrationen der Rotfront zu Straßenkämpfen mit Toten führen, in der die unwahrscheinlichste aller Regierungsparteien, die NSDAP, ihren zweiten Anlauf beginnt, die Weimarer Republik zu übernehmen.
1929 ist Berlin aber auch die Stadt der Zerstreuung, des Swings, der geworfenen Arme und Beine und der bengalischen Lichter, einer Leichtigkeit und Leichtfertigkeit ohnegleichen. In dieser Zeit, in der die Weltwirtschaftskrise dem kleinen Mann bald schon jedes Restvertrauen in die Demokratie nehmen und die Sehnsucht nach einem starken Mann dem Machtstreben Adolf Hitlers Vorschub leisten wird, kommt der Kölner Kommissar Gereon Rath (Volker Bruche) nach Berlin zur Sitte, um einer Erpressung des Kölner Bürgermeisters Konrad Adenauer auf die Schliche zu kommen.
Er kommt dabei dem Kommissar Wolter in die Quere, der die taufrische und ziemlich kecke Polizeiassistentin Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) auf Rath ansetzt. Gemeinsam kommen sie russischen Agenten Trotzkis und Stalins auf die Spur, die ihren Kampf um den rechten revolutionären russischen Weg in den Straßen Berlins austragen und in die Quere der demokratiefeindlichen Schwarzen Reichswehr.
Hier ist eine deutsche Serie, die mit großen US-Kalibern wie „Boardwalk Empire“ locker mithalten kann. Jeder Moment ist liebevoll gestaltet und akribisch ausgestattet, die Dialoge sind lebensprall, die Schauspieler (darunter Matthias Brandt, Peter Kurth, Lars Eidinger, Fritzi Haberlandt) überzeugend. Und mit dem Lied „Zu Asche, zu Staub“ ist auch noch ein Ohrwurm enthalten, passgenau hinzuerfunden zur Historie. Es ist die Welt, die Alfred Döblin in „Berlin, Alexanderplatz“ und Hans Fallada in „Kleiner Mann, was nun?“ beschrieben haben, die in Volker Kutschers Krimis und ihren kongenialen Verfilmungen neu erwacht.
Modern Family – Staffel 7. Ach was waren das noch Zeiten, als Papa Phil zu Söhnchen Luke im Darth-Vader-Modus sprach „Luke, ich bin dein Vater“, als die naive Haley ihr Handy am Kopf rieb, weil die kluge und neidische Schwester Alex ihr weisgemacht hatte, damit könne man den Akku wieder aufladen. Als Lily noch ein Hort-Kind war und ihr Daddy, Jays schwuler Sohn Mitch, ihr ein Prinzessinnenhaus im Garten bastelte.
Der Pritchett-Dunphy-Tucker-Clan war lange Zeit das lustigste, was im Fernsehen zu sehen war – und ist auch jetzt, immer noch lustiger als so manches andere. Aber alle Darsteller sind erwachsener geworden – Phil versucht seinen Sohn Luke jetzt fürs Immobiliengeschäft zu gewinnen, Haley versucht’s noch mal mit dem Ex-Lover Dylan, Mitch mit der Kunst, Luke mit dem Fahren ohne Führerschein. Vieles weitere wird versucht, wobei wir hier versuchen, das Spoilern in Grenzen zu halten.
Kritisch anzumerken ist, dass der Humor aufgesetzter geworden ist, dass manche Stars in ihren Rollen übertouren, voran Eric Stonestreet als Mitchs dünnhäutig-empathischer Ehemann Cam und Sofia Vergara als Jays heißblütige kolumbianische Ehefrau Gloria. Immer noch ist „MF“ unterhaltsam nach all den Jahren, aber wenn man wirklich Tränen lachen möchte, wählt man die Staffeln 1 bis 3. Das funktioniert auch noch beim zigsten Durchlauf.
Picnic at Hanging Rock – Miniserie. Ein Klassenausflug zu einem geheimnisumwitterten Berg im Australien des Jahres 1900. Einige der Schülerinnen kommen nicht mehr heim von ihrem Picknick, sind wie vom Erdboden verschluckt. Eine der Zurückgekehrten, zuvor zart und duckmäuserisch, ist plötzlich selbstbewusst und aufsässig, erfüllt das Internat der ebenfalls geheimnisumwitterten Mrs. Appleyard (Natalie Dormer) mit verrückten Geschichten einer Flucht vor einem unheimlichen Wesen.
Eine zweite, die nach neun Tagen gefunden wird, kann sich an nichts mehr erinnern. Eine weitere wirkt fortan wie ein kleiner Dämon. Und ein junger Adelsspross, der letzte, der die Verschwundenen sah, berichtet von zwei seltsamen „Reitern mit Hüten wie aus alter Zeit“, denen er kurz nach dem Treffen mit den Mädchen begegnet sei.
Vogelschreie und Geräusche als Soundtrack, seltsame Erscheinungen – die Serienmacher von „Picnic at Hanging Rock“ versuchen, an den altbekannten Gruselstrippen zu ziehen, das Unerklärliche paranormal einzufärben und zugleich leise aufziehendes Grauen mit Komik zu dämpfen. Doch von kruden Dialogen über unverständliche Szenen bis hin zu extrem manierierten Kameraeinstellungen misslingt hier nahezu alles.
Die Schauspielkunst geht selten über Mittelmaß hinaus, die Schauspielerführung ist dürftig. Gelang Peter Weir in der ersten Verfilmung vor mehr als 40 Jahren eine stimmige hiobsromantische Atmosphäre, so bricht hier alles entzwei. Das Rätsel vom Teufelsberg ist nach zwei Episoden uninteressant – das Schlimmste, was einer Serie passieren kann.
Muse. Der Katalane Jaume Balagueró wurde 2007 mit seinem Zombies-im-Mietshaus-Schocker „(REC)“ bekannt. Seither ist er ein Name für einigermaßen sehenswerte Thriller und Schocker. In dem Horrorfilm „Muse“ befallen den Literaturprofessor (Elliot Cowen) nach dem Selbstmord seiner Freundin Albträume über ein Verbrechen, das dann tatsächlich passiert.
An einem der Tatorte trifft er die junge Rachel (Ana Ularu), die dieselben nächtlichen Visionen hat. Hinter einer verborgenen Tür finden sie ein metallenes Ei in einem Aquarium, in das ein Dante-Zitat eingraviert ist und stoßen auf einen geheimnisvollen Literaturzirkel, dessen Mitglieder auf seltsame bis bizarre Art verstarben und auf den Mythos der Musen.
Diese übernatürlichen Frauen sind allerdings weniger sanftmütige, inspirierende Wesen, sondern boshafte Hexen, die für ihr Geben auch nehmen, nicht gern behelligt werden und ihr „Imago“ genanntes Ei zurückwollen. Poesie ist für sie ein Pferd, in unsere Welt einzureiten und dort Unheil zu stiften.
Das ist ein origineller Ansatz, der im ersten Drittel noch ein paar Nackenhärchen steilstellt, dann aber zusehends an Schrecken einbüßt, beliebig wird und konfus auf ein Ende zusteuert. Überraschend: Franka Potente („Lola rennt“) und Christopher Lloyd („Zurück in die Zukunft“) sind in Nebenrollen zu sehen.
Absentia – Miniserie. Tatsächlich sagt der eigene Bruder: „Das Leben ist schön.“ Zu der FBI-Agentin Emily, die sechs Jahre lang für tot gehalten wurde, die Gefangene eines der im TV-Universum offenbar an jedem Kneipentisch lauernden Psychokiller war. Eine, die gerade erst zurückgekehrt ist zu ihrem Mann, der inzwischen eine andere geheiratet hat, zu ihrem kleinen Sohn, der sie nicht erkennt, zu ihrem Labrador, der sie freundlich begrüßt. Ein zerbrochenes Leben.
Und es wird noch schlimmer: Bald schon ist sie nicht mehr das Opfer, sondern wird als Verdächtige geführt, als geisteskranke Mörderin. „Castle“-Star Stana Katic spielt die Hauptrolle in einem viel zu lange nur passablen Thriller mit vielversprechender Prämisse, dessen Autoren leider zu oft das Besondere mit dem Unglaubwürdigen verwechseln. Kaum anzunehmen, dass man eine Frau, die sechs Jahre in Gefangenschaft verbrachte, in Bostons verschneiten Straßen erstmals wieder ans Steuer eines Autos lässt. Völlig unglaubwürdig, die schwer Traumatisierte mit auf einen gefährlichen Polizeieinsatz zu nehmen.
Spät zündet die Serie, nimmt dann aber Fahrt auf und mündet in ein spannendes Finale (das Fans skandinavischer Krimidramen so ähnlich schon gesehen haben). Ob Bulgarien sich gut als Boston und Umgebung macht, können nur Bostoner entscheiden. Auf den ersten Blick wirkt das alles ungemein amerikanisch.
Roman J. Israel, Esquire – Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Der Anwalt Roman J. Esquire (Denzel Washington) ist der graue Hinterzimmermann in einer kleinen Zwei-Mann-Kanzlei. Sein Afro ist zu ausladend, seine Anzüge sind abgetragen, er ist aus der Zeit gefallen, nie wirklich in der Welt angekommen.
Ein ehrenwerter Mann, der an die gute alte Gerechtigkeit glaubt, der mit juristischen Tricksereien moderner Advokaten und der Herrschaft des Geldes nichts anfangen kann. Er hat ein fotografisches Gedächtnis, was ihn zu einem perfekten Rechercheur macht. Nach dem Herztod seines Kollegen droht ihm die Obdachlosigkeit, weil das hoch verschuldete Büro aufgelöst wird und Roman nicht gegen Arbeitslosigkeit versichert war. Schließlich nimmt ihn eine renommierte Anwaltskanzlei als Pro-Bono-Mann unter ihre Fittiche.
Der teigige Mann mit dem altmodischen Ehrenkodex trifft dann eine Entscheidung gegen seine Moral, mit der er sich selbst in Frage stellt und die schließlich in einem Gerichtsfall auf ihn zurückkommt. Die Geschichte, die „Nightcrawlers“-Regisseur Dan Gilroy hier erzählt, ist eigenartig, ausladend und deutlich zu lang, der Held mit seinen autistischen Zügen eine eher sperrige Figur.
Denzel Washington aber gibt alles, um die Tragik seines einsamen Charakters auszuleuchten und holt sich den Film mit seinen fahrig und konfus vorgetragenen Weisheiten und seinem Lachen, das wie ein Abwinken an eine Welt ist, die sich zugunsten des Profits von der Menschlichkeit verabschiedet hat
Feinde – Hostiles. Ein Indianer hassender Offizier der US-Kavallerie (Christian Bale) bekommt mit seinen Männern den Auftrag, einen alten, kranken Cheyennehäuptling (Wes Studi) aus der Gefangenschaft zurück in seine Heimat Montana zu bringen. Unterwegs durch feindliches Land treffen sie eine Farmersfrau (Rosamund Pike), deren Familie von Komantschen umgebracht wurde. Dann wird ihnen auch noch der Transport eines Soldaten (Ben Foster) zu seiner Hinrichtungsstätte aufgebürdet.
Dieser äußerst dramatische Ritt findet 1892 statt – die Indianerkriege sind vorbei, die weißen Vereinigten Staaten von Amerika sind auf dem Weg in ihr großes Jahrhundert, die First Nations dagegen auf dem Weg in die Reservate, ans Ende des Stolzes, in ein Leben der Demütigung. Regisseur Scott Cooper hat sich das amerikanischste aller Filmgenres vorgenommen um eine Geschichte von der individuellen Überwindung des Hasses zu erzählen.
Er zeigt Verständnis für jede seiner Figuren und bringt sie in seelische Bewegung. Die Feinde nähern sich an, sind aufeinander angewiesen, kämpfen Seite an Seite, und wenn sie auch nicht Freunde werden, so erkennen sie einander doch als Menschen und erringen Achtung voreinander.
Ein kontemplativer Western, der in unseren neuen Zeiten des Rassismus und Antisemitismus, von #MeToo und der anhaltenden Geringschätzung aufgrund des Geschlechts oder der Sexualität geradezu als Lehrstück funktioniert. Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit bringen die Menschheit voran, das pervertierte, falsche „Ich“ von Nationalismus, Populismus, Faschismus dagegen ist in seiner verführerischen Schwarz-Weiß-Einfachheit eine Zugkraft in Richtung Spaltung, Kampf und Untergang.