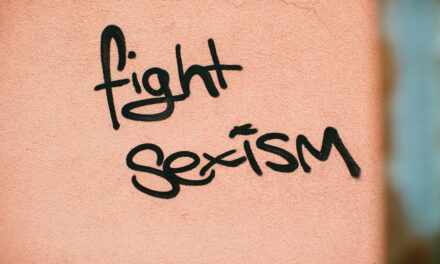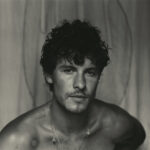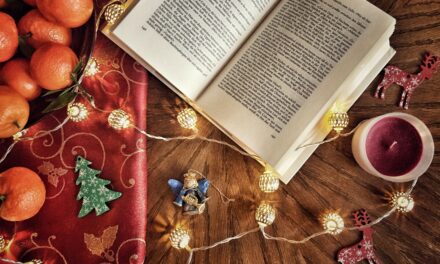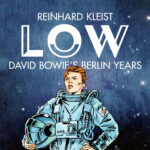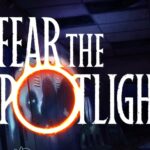Alles wird gut? Wann Positivität toxisch wird, und wie wir uns davon befreien

Es gibt viele Wege, sich dem Positiven zuzuwenden. In Ratgebern lesen wir davon, Dankbarkeit zu äußern, Achtsamkeit zu praktizieren und Krisen als Chance zu betrachten. Doch ist das immer angebracht? Welche Auswirkungen toxische Positivität hat, und wie wir uns davon befreien können.
Im Alltag begegnen uns häufig positive Glücksbotschaften in allerlei Formen. In Glückskeksen, auf Plakate oder Klamotten gedruckt, im Supermarkt oder in der Drogerie. Die Aufschriften lauten dann: „Think positive“, „You only live once“, „Be happy“. Ein positives Mindset hat durchaus viele Vorteile: Es hilft uns, das Gute in unserem Leben zu sehen, dankbar zu sein und uns energetisch zu fühlen. Doch Positivität kann auch negative Folgen haben.
Wann wird Positivität toxisch?
Toxisch wird Positivität dann, wenn kein Platz mehr für unangenehme Gefühle, Sorgen und Ängste bleibt. Menschen, die toxisch positiv sind, betreiben viel Aufwand, um sich jegliche Negativität im Gefühlsleben zu verbieten und stets optimistisch zu bleiben.
Es gibt allerdings Situationen, die sich nicht durch ein positives Mindset weglächeln lassen: Schicksalsschläge, Krankheiten und Verluste geliebter Menschen gehören ebenso zum Leben wie Glück und Freude auch.
Warum negative Gefühle wichtig sind
Negative Gefühle sind Botschafter unseres Körpers, die über unsere inneren Zustände und Bedürfnisse informieren. Wenn wir sie unterdrücken, kann sich das in körperlichen oder physischen Symptomen äußern, die Stress verursachen und zu einer Verringerung der Gedächtnisleistung beitragen können.
Anna Maas hat über das Phänomen toxische Positivität ein Buch geschrieben: „Die Happiness Lüge“. „Problematisch an toxischer Positivität ist nicht nur, dass wir unsere wahren Emotionen nicht ernst nehmen und sie wegdrücken“, sagt sie im Podcast „Smarter leben“. „Ein weiterer Punkt ist, dass die Verantwortung immer auf das Individuum geschoben wird. Da steckt eben auch drin: Wenn du nicht glücklich bist, bist du selbst schuld.“
Welche Auswirkungen hat toxische Positivität?
Wenn wir dauerhaft glücklich sind oder versuchen, es zu sein, obwohl eigentlich andere Gefühle angebracht wären, gehen wir Konflikten aus dem Weg. Dabei ist es bedeutend für die persönliche Entfaltung, laut, wütend oder frustriert zu sein und nicht oberflächlich glücklich. Jede Emotion hat ihren Platz und ihre Berechtigung.
Wenn wir laut sind und unsere Gefühle nach außen tragen, besteht die Chance, ins Gespräch zu kommen und sich zu verändern. Toxische Positivität kann auch dazu führen, dass wir Unterstützung vermeiden, was zu Isolation und Einsamkeit führt. Wenn die antrainierte Fassade der Positivität bröckelt, treten Emotionen verstärkt auf, was auch zu Instabilität in Beziehungen führen kann, weil unangenehmen Themen aus dem Weg gegangen wird.
Tipps: Wie können wir uns von toxischer Positivität befreien?
- Gefühle akzeptieren: Es ist in Ordnung, negative Gefühle zu empfinden. Wir sollten sie nicht unterdrücken.
- Unterstützung suchen: Wenn wir Schwierigkeiten haben, mit negativen Empfindungen umzugehen, können wir uns an Freunde, Familie oder psychologisches Fachpersonal wenden. Nach Hilfe zu fragen ist keine Schwäche.
- Lernen, mit Stress umzugehen: Stress kann negative Emotionen verstärken. Es gibt aber Techniken, um Stress abzubauen, zum Beispiel Sport, Entspannungstechniken oder Meditationen.
- Social-Media-Zeit begrenzen: Social Media übt Druck auf unseren Alltag und unser Leben aus, den wir nicht immer bewusst wahrnehmen. Sich bewusst weniger auf sozialen Plattformen zu bewegen oder sich von Accounts zu lösen, die einem nicht guttun, kann uns helfen, nicht so viel Druck in uns zu empfinden, perfekt und gut gelaunt sein zu müssen.
Von Kira Dressler
Lies auch: