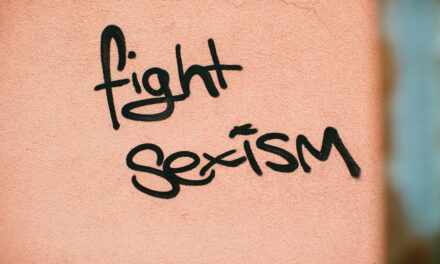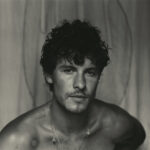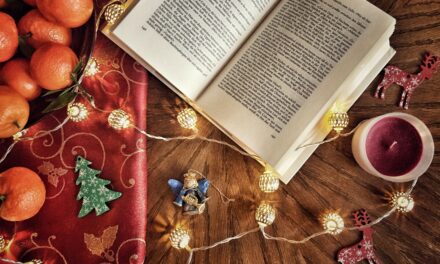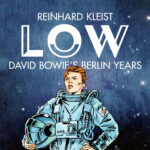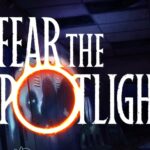Von Comedy bis True Crime: Warum sind Podcasts so beliebt?

Podcasts werden immer beliebter. Woran das liegt und ob sie die Gesellschaft beeinflussen können, erklärt Musik- und Kommunikationswissenschaftler Nicolas Ruth im MADS-Interview.
Menschen haben ein kommunikatives Grundbedürfnis: Das könnte einer der Gründe für den Erfolg von Podcasts sein. Noch dazu wollen immer mehr Menschen ihre Zeit mehrfach verwerten – also beim Putzen zum Beispiel nebenbei noch etwas hören. Da bieten sich Podcasts an. Natürlich kann Musik diesen Zweck ebenfalls erfüllen. Doch der Hype um Podcasts reiß nicht ab: Allein 2022 haben rund 30 Millionen Menschen in Deutschland Podcasts gehört.
Eine Studie der Ad Alliance belegt: Rund ein Drittel hört sie mindestens einmal die Woche. Die Studie stellt außerdem eine gesteigerte Nutzungszeit fest, vor allem von Wissensformaten, Nachrichten, Comedy und True Crime. Worin liegt dieser exponentielle Erfolg?
Professor Dr. Nicolas Ruth ist Musik- und Kommunikationswissenschaftler sowie Leiter des Masterstudiengangs Digitale Kommunikation in der Musik- und Entertainmentindustrie an der Hochschule für Musik und Theater München.
Es gebe immer mehr Freizeitangebote, die miteinander konkurrierten, sagt Ruth – insbesondere im Medienkonsum. Musik konkurriere etwa mit Youtube oder Tiktok. Allerdings geht er davon aus, dass der Erfolg von Podcasts nicht unbedingt negativ für die Musik sei. Im Gegenteil: Gerade die Menschen, die über Musik sprechen, würden auch dazu angeregt, sich neue Songs anzuhören oder zu entdecken. Die Motivation, Musik zu hören, liege nahe bei der, einen Podcast zu hören. Beides sei oft emotionale begründet. Podcasts werden zudem häufig auch zum Einschlafen genutzt.
Ruth stellt allerdings auch einen Unterschied heraus: „In der Medienpsychologie wird häufig von einem eudaimonisch motiviertem Hören gesprochen“, sagt er. Demnach werden Podcasts aus einem informationsbedürftigen Verhalten heraus gehört. Es gehe um den Wunsch, sich mit etwas auseinanderzusetzen, was uns informiert, um am Ende des Tages das Gefühl zu haben, dass wir unser Gehirn eingesetzt haben.
Warum hören wir Podcasts?
Eine Studie von Media Market Insights hat die psychologische Wirkung des Formats analysiert. Die Studie stellt fest, dass sich Menschen Podcasts hauptsächlich zur Entspannung anhören. Dabei fokussieren sie sich voll auf das Hören, sodass sich der Körper frei und entspannt fühlt.
Ein anderer Grund ist die Übergangsnutzung von Podcasts, um Wege zur Uni, Arbeit oder ähnlichem zu überbrücken. Gelegentlich werden Podcasts auch als Flucht vor Situationen oder vor sich selbst genutzt. Besonders werden Podcasts allerdings gehört, um unliebsame Tätigkeiten wie beispielsweise das Putzen zu beschleunigen oder schöner zu gestalten.
Das bestätigt auch eine Studie von Julep und Pilot, welche die Nutzung von Podcasts ebenfalls in vier Kategorien aufteilt. Hier wird unterschieden zwischen Selbstresonanz (um Stress oder negative Gedanken abzubauen), sozialer Resonanz (um einer Gemeinschaft anzugehören), thematischer Resonanz sowie situativer Resonanz (um Langeweile zu überbrücken). Die Studie zeigt aber auch: 25 Prozent aller Podcasts scheitern und veröffentlichen nur eine Folge.

Gibt es mittlerweile zu viele Podcasts?
Auch bei Podcasts besteht mittlerweile ähnlich wie bei anderen medialen Formaten eine Art Über-Angebot, doch deswegen müssten neue Projekte längst nicht zwingend scheitern, meint Ruth. Gerade die Top 100 hätten enorme Nutzungszahlen. Gerade durch die Vielfalt der Podcast-Landschaft ließen sich unterschiedliche Nischen bedienen und es gebe so auch immer eine kritische Masse an Hörenden, sagt der Experte. Er verweist auf das Paradigma von „1000 true fans“ in der Musik, nach dem man zum Erfolg 1000 wahre Fans brauche, die bereit sind, Geld für das Produkt zu zahlen.
Als Massenmedium untauglich?
Podcasts können mittlerweile also ebenfalls als ein Massenmedium gehandelt werden. Dennoch: Dass sie die Gesellschaft beeinflussen können, glaubt Ruth nicht. Sie können aber helfen, sich mit Themen auseinanderzusetzen, auf die man selbst nicht gekommen wäre. Beispielsweise hätten True-Crime-Podcasts das Interesse an Kriminalität deutlicher geweckt, als es die populäre ARD-Krimireihe „Tatort“ bisher geschafft habe.
„Das ist ein spannendes Phänomen, was uns, glaube ich, in eine neue Richtung gebracht hat. Und was witzigerweise wieder andere Medienformate beeinflusst hat“, sagt Ruth und ergänzt: „Die „Zeit“ bringt mit „Zeit Verbrechen“ seit einiger Zeit ein erfolgreiches Druckmagazin raus, in dem Kriminalfälle dargestellt werden. Ursprünglich sollte der gleichnamige Podcast nur das Nebenprodukt sein, ist aber jetzt das Zugpferd für das Magazin.“
Von Olivia Bodensiek
Lies auch: