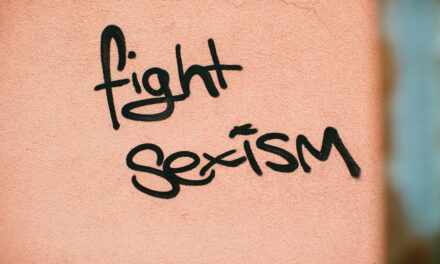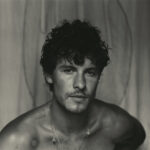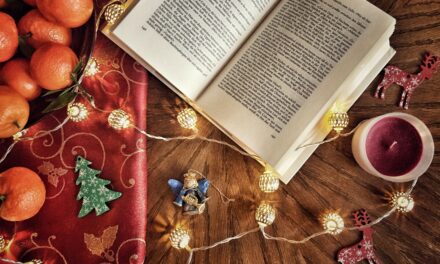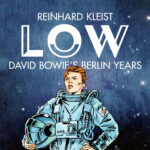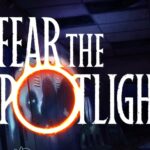Ausleihe von E-Books: Einfacher Zugang zu Büchern vs. schlechte Bezahlung

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat untersucht, welche Auswirkungen die Ausleihe von E-Books, das sogenannte E-Lending, in öffentlichen Bibliotheken hat. Besonders Autorinnen und Autoren sind mit den aktuellen Bedingungen unzufrieden.
Sie bieten Menschen mit wenig Geld einen einfachen Zugang zu Literatur: Bibliotheken. Wer jetzt an staubige alte Schinken denkt, hat sich womöglich länger nicht mit den Angeboten in der örtlichen Bücherei auseinandergesetzt. Viele bieten nämlich auch das sogenannten E-Lending, vielerorts auch „Onleihe“ genannt, an – sie verleihen also E-Books. Dabei handelt es sich also grundsätzlich um einen ähnlichen Prozess wie bei der gewohnten Buchausleihe. Doch es gibt erhebliche Unterschiede – und Kritikpunkte.
Derzeit werden Lizenzverträge für Bücher durch den Verlag verhandelt. Dabei geht es darum, wie viele Lizenzen vergeben werden und wie viele Ausleihen pro Lizenz möglich sind. Gerade große Verlage haben mehr Freiraum zum Verhandeln als kleinere Verlage, die ihre Lizenzen häufig günstig und unlimitiert rausgeben.
Der Verdienst für Autorinnen und Autoren und die Verlage ist bei einer Ausleihe natürlich geringer als beim Verkauf der Bücher in Buchhandlungen. Doch beim E-Lending verdienen Autorinnen und Autoren mehr als über die Verleihe von Print-Ausgaben ihrer Werke. Generell ist die Ausleihe von Print-Büchern per Verleihrecht gesichert. Aktuelle Gesetzesauflagen gewähren es Autorinnen und Autoren allerdings, dem Verleihrecht entgegenzuwirken und die Ausleihe ihrer Bücher zu unterbinden.
Ausleihe von E-Books: Ausbeute oder Fortschritt?
Der Deutsche Bibliotheksverband (DBV) fordert für E-Books dasselbe Verleihrecht wie für Print-Bücher. Ab dem Tag der Veröffentlichung sollen E-Books für Bibliotheken zugänglich sein. Zurzeit ist es so, dass Verlage ihre E-Books erst bis zu einem Jahr nach Veröffentlichung lizenzieren. Autorinnen und Autoren argumentieren gegen die DBV-Forderung. Sie sehen es als Kontrahierungszwang, denn sie wären nicht mehr in der Lage, den Verleih ihrer Bücher zu verhindern. Der DBV begründet seine Befürwortung damit, dass „angemessene Bedingungen“ geschaffen werden sollen.
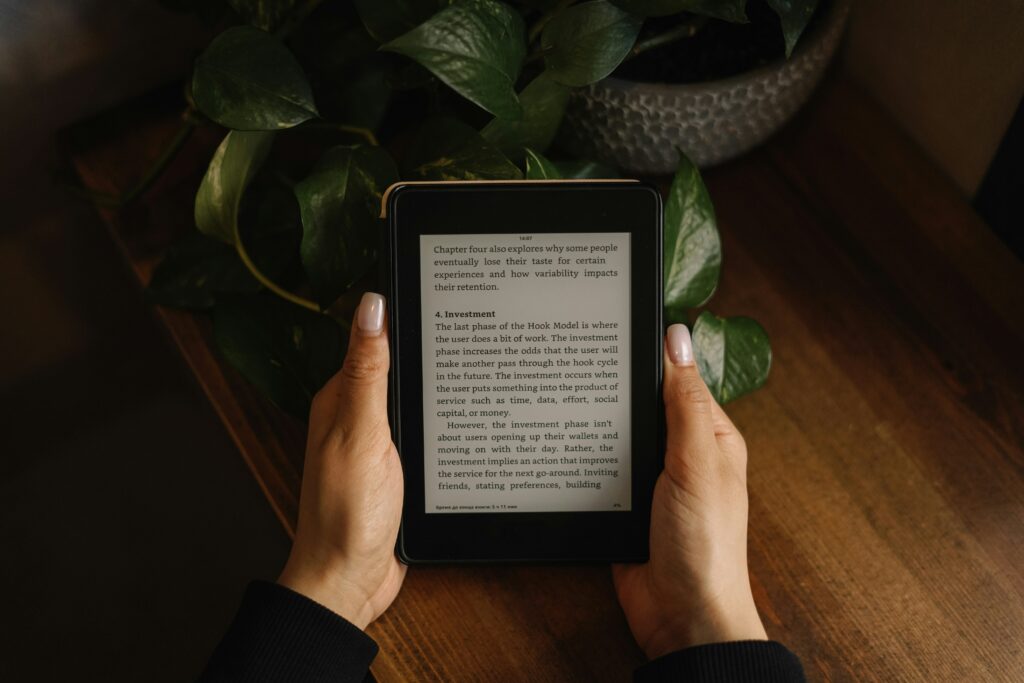
Grundsätzlich ist es so, dass Autorinnen und Autoren durch Verträge mit ihren Verlagen vergütet werden. Zudem gibt es gesetzliche Regelungen, bei welcher Bund und Länder eine Vergütung pro physische Verleihe zahlen – sogenannte Bibliothekstantiemen. Im Jahr 2018 erhielten Autorinnen und Autoren pro Buchausleihe 4,3 Cent zusätzlich zum Kaufpreis des Buches. Da es noch keine Gesetzesauflage gibt, wird zurzeit noch keine Vergütung von Bund und Ländern für E-Lending an die Autorinnen und Autoren ausgezahlt. Sie erhalten derzeit also nur das Geld von den Verlagen für die Lizenzen, keine Tantiemen.
Seit zwei Jahren befasst sich auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth mit dem Thema dafür und rief einen Runden Tisch zum E-Lending ins Leben. Passiert ist bisher noch nichts Konkretes – von einer Studie zum Einfluss der Online-Ausleihe auf den Buchmarkt abgesehen. Das soll sich jedoch ändern. „Wir haben uns im Koalitionsvertrag zum Ziel gesetzt, faire Rahmenbedingungen für das E-Lending zu schaffen“, sagte die Grünen-Politikerin. „Dabei müssen wir aber die soziale Lage der Kreativen im Blick behalten und eine angemessene Vergütung für Autoren- und Übersetzungsleistungen sowie die Verlagsarbeit gewährleisten.“
Macht E-Lending Lesen zugänglicher?
Der Zugang zu Büchern wird durch das E-Lending zumindest einfacher. Denn um E-Books auszuleihen, muss niemand seine vier Wände verlassen. Geht es nach der Forderung des DBV, könnten die Buchverkäufe zurückgehen. Denn in diesem Fall wären alle Bücher direkt zum Erscheinen online zugänglich, sofern man einen Bibliotheksausweis besitzt.
Von Emily Kleinert
Lies auch: